
Bei der Realisierung von Hochbauvorhaben ist der Tragwerksplaner während der Rohbauphase der wichtigste Fachberater des Architekten. In der Planungsphase unterstützt er den Objektplaner bei allen Angelegenheiten hinsichtlich statischer Probleme. Während der Ausführung liefert er alle erforderlichen Pläne nach denen der Rohbau hergestellt wird. Zur Vollständigkeit der einzelnen Leistungsphasen ist der Tragwerksplaner zu zeichnerischen Darstellungen verpflichtet.
Übersicht

In der Vorplanung sucht der Tragwerksplaner nach einer Konstruktionslösung, welche die Standsicherheit, Gebrauchsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Gebäudes gewährleistet. Es ist dabei erforderlich mehrere Tragwerkslösungen zu untersuchen. Auch in diesem Stadium ist bereits an die Genehmigungsfähigkeit zu denken, die zum Beispiel Einschränkungen bei der Wahl der Materialien zur Folge hat. Der Wirtschaftlichkeitsvergleich kann im Hochbau in zwei Punkte gegliedert werden. Im ersten Teil wird die Gründung untersucht. Hier wird zwischen einer Flachgründung (Streifen- und Einzelfundamente oder Fundamentplatten) und einer Tiefgründung (Pfahlgründungen, Brunnen und Senkkasten) getrennt. Ob Flach- oder Tiefgründung hängt maßgeblich von den Baugrund- und Grundwasserverhältnissen ab. Innerhalb dieser Gründungsarten spielen die gewünschte Nutzung und Kosten eine entscheidende Rolle. Der zweite Punkt betrifft die Tragkonstruktion. Dieser gliedert sich in die drei üblichen Ausführungsarten im deutschen Hochbau:
· Rahmenkonstruktionen
Der Preisvergleich sollte nicht nur auf eine Vergleichsrechnung zwischen Herstellungskosten in Bezug auf die Beton- und Bewehrungsmassen basieren, sondern auch auf die Folgekosten wie z.B. größere Fassadenflächen, Kosten für die Gebäudetechnik und Betriebskosten abgestimmt sein. Hierzu bedarf es einer Koordination zwischen den einzelnen Planern.
Zu diesem Zeitpunkt erfolgt noch keine zeichnerische Darstellung, sondern nur eine Weitergabe von Skizzen des statischen Systems (mit Alternativen) und den Grundgedanken eine akzeptierbaren Lösung an den Objektplaner.
Die Aufgabe des Statikers während der Planungsphase ist, die beste Variante der Vorplanung weiter zu verfolgen und eine optimale Tragwerkslösung zu finden. Dabei muss eine Abstimmung mit dem Objektplaner und den in die Planung einbezogenen Fachplanern erfolgen. Der wichtigste Punkt für die Tragwerksplanung ist hierbei das Stützenraster . Mit der Schlusskoordination der Entwurfsplanung legt der Tragwerksplaner einen optimierten, konstruktiven Entwurf mit einer überschlägigen statischen Berechnung vor.
Vor dem eigentlichen Beginn der Entwurfsplanung ist es notwendig alle erforderlichen Angaben und Unterlagen vom Bauherrn/Nutzer einzuholen. Die wichtigste Information ist hierbei dessen Stellungnahme und Entscheidung zu den Ergebnissen der Systemunterlagen der Vorplanung (Konstruktionsart, Raster, Material usw.). Weitere Angaben durch den Bauherrn sind eventuelle baurechtlichen Auflagen, besondere Anforderungen an das Tragwerk und einzuhaltende Sicherheitsbestimmungen.
|
Weitere benötigte
Angaben / Unterlagen: |
Bauherrn
/ Nutzer |
Objektplaner |
Technik-
planer |
Bodengut-
achter |
|
- Eventuelle baurechtlichen Auflagen |
n |
|
|
|
|
- Besondere Lastfälle durch den geplanten Betrieb |
n |
|
|
|
|
- Lastangaben für Großgeräte |
n |
|
n |
|
|
- Lastangaben und Anforderungen aus dem Ausbaukonzept |
|
n |
n |
|
|
- Entwurfskonzepte (Rohlinge) mit allen wesentlichen Maßen |
|
n |
|
|
|
- Gründungsschnitte und Geländeschnitt |
|
n |
|
|
|
- Detailpläne über wesentliche Tragwerksteile (Schächte, Kerne, Treppen, Fassade, Fluchtbalkone, Dachaufbauten) |
|
n |
|
|
|
- Trassenführung mit Angaben der benötigten Regelaussparungen und der Sonderaussparungen |
|
n |
n |
|
|
- Klärung der Schachtein- und Ausführungen |
|
|
n |
|
|
- Stellungnahme zur vorgeschlagenen Gründungsart |
|
|
|
n |
|
- Angabe der zulässigen Bodenpressungen |
|
|
|
n |
|
- Grenzwerte für die Setzungsberechnung |
n |
n |
n |
n |
|
- Vorläufiger Verlauf der Bodenschichten |
|
|
|
n |
Wie bereits erwähnt, ist die Tragwerkslösung im Hochbau vom Stützenraster abhängig. Dies kann der Statiker aus den Vorabzügen des Architekten entnehmen. Für die Tragwerkslösung ist das hauptsächliche Raster entscheidend. Aus dem Wunsch des Objektplaneres muss ein Maximum an Wirtschaftlichkeit bei Einhaltung der Gebrauchsfähigkeit (Deckendurchbiegungen) erarbeitet werden. Für die Einhaltung der zulässigen Verformungen haftet der Tragwerksplaner. Zu beachten sind eventuelle Unregelmäßigkeiten im Stützenabstand durch Nutzung oder technische Gebäudeausrüstung. Ergeben sich daraus geänderte Abmessungen (z.B. höhere Unterzüge oder Abfangträger), muss dies allen Fachingenieuren mitgeteilt werden. Ein anderer Grund für Änderungen von Bauteilabmessungen können unterschiedliche Nutzungsbereiche mit verschieden hohen Verkehrslasten sein. Bei der Trassenplanung von Versorgungsleitungen hat der Tragwerksplaner die Aufgabe, notwendige Aussparungen hinsichtlich der statischen Durchführbarkeit zu überprüfen.
|
Entwurfsskizzen |
Entwurfsskizzen des Tragwerks zeichnet man in der Regel im Maßstab 1:100. Sie lassen keine Details erkennen, jedoch muss die Art der Lastabtragung ersichtlich sein. Wichtige Knotenpunkte, die das spätere optische Bild des Gesamttragwerks beeinflussen, sollten in einem größeren Maßstab skizziert werden.
|
Rohpositionspläne |
Aus den Rohpositionsplänen müssen die geplanten Tragkonstruktionen (Gründung, Lastabtragung, Decken- und Dachkonstruktion) ersichtlich sein.
Die Inhalte entsprechen den entgültigen Positionsplänen (vgl. Punkt 4.3.1)
Der Tragwerksplaner schuldet die erforderlichen bautechnischen Nachweise für eine dauerhafte Baugenehmigung. Dazu gehören eine prüffähige, statische Berechnung der Standsicherheit und Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile. Unter Umständen fällt in dessen Bereich auch der vorbeugende Brandschutz, sowie der Schall- und Wärmeschutz, wenn kein weiterer Fachplaner in die Planung integriert wird. Für die Bearbeitung des vorbeugenden Brandschutzes werden zugelassene beratende Ingenieure oder Architekten mit 10 Jahren Berufserfahrung von den Genehmigungsbehörden akzeptiert. Das Ergebnis ist ein Brandschutzkonzept mit Fluchtwegen, Brandabschnitten, Brandwände, usw. (vgl. Punkt 3.3.2.4). In den Nachweisen des Schall- und Wärmeschutzes werden Luft- und Trittschall, Außenlärm bzw. Wärmedämmung und Energieeinsparung nachgewiesen. Ferner leitet der Statiker seine ermittelten Beton- und Stahlmassen an den Objektplaner weiter, der diese für die Kostenberechnung benötigt.
|
Positionspläne |
Alle tragende Bauteile werden in einem Positionsplan
im Maßstab 1:100 dargestellt. Durch die Gesamtorientierung
wird die statische Berechnung prüfbar. Nicht tragende Bauteile sind nur im
Ausnahmefall mit in den Plan aufzunehmen und besonders zu kennzeichnen. Ein
Positionsplan sollte im einzelnen folgendes beinhalten:
- Spannrichtungen der plattenartigen Bauteile
Deckenplatten sind hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Diese hängt neben der Deckenstärke auch von der Bewehrung (ein- oder zweiachsig gespannt) ab. Ferner sollte man darauf achten, dass bei Halbfertigteil- bzw. Fertigteilplatten eine rationelle Herstellung durch viele gleiche Teile möglich ist.
- Eindeutige Kennzeichnung der Bauteile mit Positionen aus der Statik
Es empfiehlt sich hierbei eine Gliederung hinsichtlich der Tragweise der Bauteile.
Zum Beispiel :
Stabförmige Bauteile: Stützen S
Unterzüge UZ
Fundamentbalken FB
.......
Platten und Scheiben: Wände W
Decken D
Mauerwerkswände MW
.......
Für eine gute Übersichtlichkeit ist es sinnvoll geschoßweise übereinanderliegende Bauteile immer mit der selben Nummer zu versehen. Bei größeren Baumaßnahmen erfolgt die Aufteilung in Bauabschnitten analog den Bauwerksfugen.
- Darstellung mit Blick in die leere Schalung
- Festigkeitsklassen der Baustoffe für tragende Bauteile nach DIN oder Zulassung
- Größere Durchbrüche mit Einfluss auf die Statik
Lage und Abmessungen müssen mit allen Beteiligten angesprochen werden.
Darstellungen
zur Orientierung
- Hauptabmessungen des Bauwerks und Bauteilsbezeichnung
- Achsmaße
- Fugen
|
Lastenpläne |
In den Lastenplänen sind die aufsummierten Lasten der darüber liegenden Stockwerke einzutragen. Im Grunde ist für die Weiterbearbeitung nur ein Lastenplan für das unterste Geschoss notwendig. Denn dieser ist die Grundlage für das Urteil des Bodengutachters und eine optimierte Gründung. Die Lasten werden auf OK Fundament bezogen und stammen entweder aus der Vorstatik oder der entgültigen statischen Berechnung. Ein wichtiger Punkt bei der Kontrolle der Lastenpläne ist die Plausibilität der Werte.
Unter Angabe des Kraftangriffspunktes, ± Angaben und Unterscheidung in ruhender und dynamischer Belastung. Folgende Lasten werden eingetragen:
Einzellasten unter Einzelfundamenten in kN
Streckenlasten unter Streifenfundamenten in kN/m
Flächenlasten unter Fundament- und Bodenplatten in kN/m²
Momente aus Einspannungen in kNm bzw. kNm/m
Hierfür gibt es die „Richtlinie
für das Aufstellen und Prüfen EDV-unterstützter Standsicherheitsnachweise
(Ri-EDV-AP-2001
)“. Diese Richtlinie wird automatisch Vertragsbestandteil, wenn die ZTV-K (Zusätzliche
Technische Vertragsbedingungen für Kunstbauten) vereinbart sind. Es wird darin
jedoch als wünschenswert geäußert, dass die Richtlinie auch außerhalb der
ZTV-K an Einfluss gewinnt. So könnte man erreichen, dass die Aufgabenverteilung
-Zuständigkeit und Verantwortlichkeit zwischen Aufsteller und Prüfingenieur-
eindeutiger geregelt ist. Daher kann der Inhalt dieser Richtlinie auch für
Standsicherheitsnachweise im Hochbau herangezogen werden. Für die Vollständigkeit
eines Standsicherheitsnachweises zur Prüfung und Dokumentation gehören:
- Programmkenndaten
Diese Informationen sind in deutscher Sprache zu verfassen und sollen den Programmnamen mit Systemzuordnung, die aktuelle Version und das Freigabedatum enthalten.
- Formale Gestaltung
Diese Anforderung zählt in der Richtlinie nicht zum Mindestumfang. Eine übersichtliche Gestaltung empfiehlt sind in jedem Fall. Hierzu zählt ein Inhaltsverzeichnis, die Kennzeichnung der Seiten und Querverweise. Zusätzlich sollen die Begriffe, Formelzeichen und Einheiten den aktuellen technischen Baubestimmungen entsprechen. Die verwendeten Ordnungssysteme für Positionsnummern, Knoten- und Elementnummerierungen, Lastfallbezeichnungen, Vorzeichenkonventionen und Koordinatensysteme sind ebenfalls eindeutig zu wählen und zu erläutern.
- Eingaben für die Berechnung
Die Herkunft der Eingaben für die Berechnung muss ersichtlich sein. Dazu müssen alle Baustoffe mit ihren Materialkennwerten, Querschnittsgrößen, Steifigkeiten, Elastizitätsmodulen und Querdehnzahlen angegeben werden. Im graphisch dargestellten statischen System müssen Lager, Gelenke, Federn, Schraub- und Schweißanschlüsse eingezeichnet sein. In der Lastaufstellung sind alle Lastfälle mit den Teilsicherheitsbeiwerten und Lastfallkombinationen mit Kombinationsbeiwerten zusammenzustellen. Bei allen Eingaben ist auf die geltenden Normen und Vorschriften zu verweisen.
- Ergebnisse
Prinzipiell wird zwischen maßgeblichen (diese müssen mindestens angegeben werden) und sonstigen Ergebnissen unterschieden. In der Richtlinie werden die maßgeblichen Ergebnisse so definiert: „.... alle Daten, die für die Prüfung und Beurteilung der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Tragwerks und einzelner Tragwerksteile erforderlich sind.“ Hierzu zählen Lastfälle und Lastfallkombinationen, Bemessungskräfte, Materialgüte, Herstell- und Nutzungsvorgaben und erforderliche Zwischenergebnisse. Zu den sonstigen Ergebnissen zählen alle übrigen.
In einem Streitfall, bei dem es um die Frage geht: „Darf der Bauunternehmer allein nach den Statikerplänen bauen?“ hat das OLG Düsseldorf entschieden: „Der Bauunternehmer kann davon ausgehen, dass er nach den Statikerplänen bauen soll, wenn er lediglich die Genehmigungsplanung 1:100 und die Pläne des Statikers erhält.“ [1] Es wird sogar noch einen Schritt weiter gegangen und erläutert, dass der Bauunternehmer nicht verpflichtet ist, die ihm übergebenen Statikerpläne mit der Genehmigungsplanung zu vergleichen und den Bauherrn auf Abweichungen hinzuweisen. Daher ist der Verfasser der Zeichnungen immer aufgefordert, diese mit den Vorgaben des Objektplaners zu vergleichen und Differenzen anzuzeigen. Die Tragweite der Haftung des Statikers wird durch einen Leitsatz der BauR -Redaktion deutlich: „Der Tragwerksplaner ist verpflichtet, Unklarheiten in der Ausführungsplanung des Architekten (im speziellen Fall die Maße einer Säule in der Tiefgarage) zuverlässig zu klären, bevor er die Säule im Schalungsplan versetzt. Gegenüber dem Schadensersatzanspruch des Bauherrn kann sich der Tragwerksplaner nicht mit Erfolg auf ein Mitverschulden des Architekten wegen unzureichender Überprüfung des Schalplanes berufen.“ Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, bedarf es einer Projektorganisation der Tragwerksplanung. Es werden nicht nur interne Schnittstellen der einzelnen Konstruktionsbereiche berücksichtigt, sondern zusätzlich zu jedem Zeitpunkt die Abstimmung zu anderen Planern.
Der Projektleiter der Tragwerksplanung ist verpflichtet, interne Änderungen der Tragkonstruktion sofort an die externen Planungsstellen weiterzugeben. Dadurch kann zum Beispiel vermieden werden, dass Stützen breiter sind als Unterzüge. Gegenläufig müssen auch Modifikationen anderer Fachplaner an alle davon betroffenen Konstrukteure weitergegeben werden.


Abbildung 5: Cinemax Würzburg (Foto: Stefan
Bauereiß)
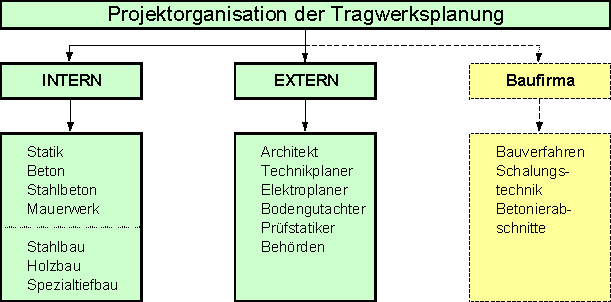
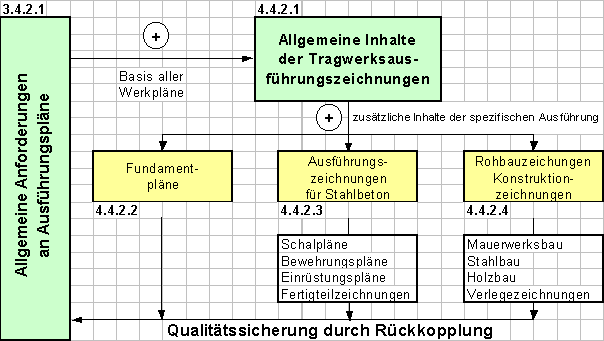
Die allgemeinen Inhalte setzen
sich aus zwei Teilen zusammen. Erstens den „Allgemeinen Anforderungen an
Objektausführungsplänen“ aus Punkt 3.4.2. Die Inhalte der Ausführungszeichnungen
der Tragwerksplanung sind darauf zu prüfen und zusätzlich mit den Vorgaben der
statischen Berechnung zu vergleichen. Im zweiten Teil sind die Abstimmungen der
folgenden Schnittstellenprobleme mit den anderen Fachplaner zu untersuchen:
- Aussparungen im Beton und Mauerwerk die durch nachträgliche Kernbohrungen hergestellt werden
In der Regel handelt es sich hierbei um Aussparungen mit einem Æ < 20cm. Hierfür muss der Tragwerksplaner die möglichen Bereiche bzw. diejenigen mit statischer Relevanz angeben.
- Vertikale und horizontale Schlitze
- Zulässige Toleranzen
- Größere Aussparungen
- Arbeits- und Dehnfugen
Abstimmung auf die Gebrauchstauglichkeit und Angabe des Werkstoffs und der Breite
- Bauart und Maße der Fundamente
Neben den Abmessungen sollen mindestens die Höhenkoten von UK- und OK- Fundament sowie OK-Gründungssohle angegeben werden. Außerdem sind Angaben erforderlich, ob das Fundament geschalt oder gegen das Erdreich betoniert wird.
- Sauberkeitsschicht mit Stärke und Betongüte
- Darüber liegende Wände, Stützen, Treppen und Schornsteine in Strichlinien dargestellt
- Höherliegende Gründungen in Strichlinie
- Vouten, Abtreppungen, Fundamentversprünge
- Aussparungen und Durchbrüche
- Grundleitungen mit Fließrichtung, Material und Durchmesser
Gibt es dafür keinen separaten Plan von einem Fachplaner ist die Abstimmung mit dessen Vorgaben zu überprüfen.
- Fußbodeneinläufe
- Aufbau unter der Bodenplatte (Sauberkeitsschicht, PE-Folie, kapillarbrechende Schicht, Geotextil)
- Magerbetonauffüllungen mit Maßen und Höhenkoten
- Bereiche mit Bodenaustausch
- Dämmarbeiten unter der Bodenplatte
- Regelschnitte der Bodenplatte, Streifen- und Einzelfundamente, verdübelte Bodenplatten
- Unterfangungen der bestehenden Bebauung
Wenn sich die geplante Bebauung auf die bestehende auswirken kann, ist in jedem Fall vor Beginn der Arbeiten zu kontrollieren, ob eine Beweissicherung stattgefunden hat.
- Baugrube mit Böschung, bzw. Spritzbetonschale, Verbau
Die allgemeinen Anforderungen für Zeichnungen des Stahlbetonbaus sind in der DIN 1045 Abs. 3.2 festgelegt. Diese sind jedoch sehr allgemein formuliert: „Die Bauteile, ihre Bewehrung und alle Einbauteile sind auf den Zeichnungen eindeutig und übersichtlich darzustellen und zu vermaßen. Die Darstellungen müssen mit den Angaben in der statischen Berechnung übereinstimmen und alle für die Ausführung der Bauteile und für die Prüfung der Berechnung erforderlichen Maße enthalten.“ Ferner wird geregelt, dass alle nachträglichen Änderungen für alle in Betracht kommenden Zeichnungen (dazu zählen auch Pläne des Objektplaners) zu berichtigen sind.
|
Inhalte von
Schalplänen |
Schalpläne
sind für alle Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauteile
erforderlich und enthalten alle wichtigen Informationen aus den
Rohbauzeichnungen die für den Schalvorgang notwendig sind. Der Umfang der
Inhalte und Anzahl der Schnitte muss so gewählt werden, dass der Unternehmer in
der Lage ist seine Arbeiten ordnungsgemäß auszuführen. Die Grundlage eines
Schalplans ist der dazugehörige Ausführungsplan des Objektplaners und die
statische Berechnung des Tragwerksplaners. Die Darstellung
erfolgt in Grundrissen gemäß DIN 1356 Grundriss TYP B mit „Blick in die
leere Schalung“ und Schnitten im Maßstab 1:50.
- Abmessungen aller tragender Bauteile
- Deckenstärke
- Aussparungen
Im Hochbau werden im allgemeinen Aussparungen mit Æ <20cm nachträglich durch Kernbohrungen hergestellt. Größere Aussparungen müssen geschalt werden und sind somit darzustellen. Im einzelnen sind dies Aussparungen für:
o Durchdringungen für die HLS- und ELT-Trassen
o Dachdurchdringungen
o Bodenabläufe
o Einbauteile für Aufzüge, Kamine und sonstiger technischer Gebäudeausrüstung
o Brandschutzklappen
- Auflager der einzuschalenden Bauteile
- Angaben von Baustoffen mit Festigkeitsklassen und Einbauhinweisen
- Deckenabsenkungen für Einbauten (z.B. Fertignasszellen)
- Betonierfugen
- Einbauteile für spätere Befestigungen (z.B. Abdeckplatten, Ankerschrauben, Geländer) und Einbindungen
Diesbezüglich sind Angaben darüber zu machen, wer für die Lieferung zuständig ist. Sind die Einbauteile vom Bauunternehmer zu liefern, muss der Zusatz: „Bauseitig liefern“ vermerkt sein.
- Kennzeichnung der Sichtbetonoberflächen [2]
Der Begriff Sichtbeton ist in keinem Regelwerk definiert. Man versteht derzeit darunter Betonflächen mit Anforderungen an das Aussehen nach DIN 18 217 „Betonflächen mit Schalungshaut“. Daher reicht der Wortlaut „Sichtbeton“ für eine genaue Beschreibung nicht aus. Gegebenfalls ist ein Schalungsmusterplan erforderlich, in dem die besonderen Merkmale vom Planer festgelegt werden.
- Fasen an Betonbauteilkanten
|
Inhalte von
Bewehrungsplänen |
Neben der Darstellung der Bewehrung im Stahlbeton- und Spannbetonbau sind auch listenförmige Aufstellungen (Stahllisten und Biegeformen) der Bewehrungsstäbe verlangt. Bewehrungszeichnungen müssen den Anforderungen zum Biegen, als auch zum Verlegen der Bewehrung genügen. Regelungen dazu -wenn auch sehr knapp gefasst- findet man in der DIN 1356 Teil 10 und etwas ausführlicher in der DIN 1045 Abs. 3.2. Hier werden die Mindestanforderungen an die Bewehrungsdarstellung, Biegeformen und Stahllisten genannt. Bezüglich der Darstellung ist es notwendig jeden Bewehrungsstab in Ansicht und Schnitt zu zeichnen und dabei die Bewehrung dicker als die Bauwerkskanten darzustellen. Anzugeben sind mindestens die Positionsnummer, Anzahl und Stabdurchmesser in mm. Zusätzlich kann es erforderlich sein Betonstahlsorte, Stababstand, Lage und die Stablänge in cm zu vermerken. Bei Betonstahlmatten verhält sich die Darstellung gleichermaßen. Anzuführen sind immer Positionsnummern, Mattenkurz-bezeichnungen und eventuell noch Betonstahlsorte.
Mindestanforderungen nach DIN 1356 Teil 10 und DIN 1045 Abs. 3.2:
- Hauptmaße der Bauteile und des Bauwerks
Abweichend zu den allgemeinen Anforderungen aller Tragwerksausführungszeichnungen aus Punkt 4.4.2.1 ist es in Bewehrungsplänen nicht notwendig alle Bemaßungen einzutragen.
- Anzahl, Durchmesser, Form und Lage der Bewehrungsstäbe
Dazu zählen auch zusätzliche Verbindungen wie Muffen, Ankerkörper usw.
- Einzel- und Teillängen der Bewehrungsstäbe
- Nennmaß nom c der Betondeckung
Dabei ist neben den Bestimmung der DIN 1045 zu prüfen, ob im angegeben Maß die Brandschutzklasse berücksichtigt worden ist.
- Biegerollendurchmesser
- Positionsnummern
- Darstellung der Biegeformen
Die Biegeformen müssen auf eine Positionsnummer bezogen sein. Dabei kann die Darstellung unmaßstäblich erfolgen.
- Orientierungsmöglichkeit über die Lage des Bauteils
- Verankerungs- und Übergreifungslängen
- Rüttellücken
- Anordnung und Ausbildung von Schweißstellen
- Betonstahlgüte und Betonfestigkeitsklassen mit Anlehnung an DIN 1045 bzw. EC2
Zusätzlich müssen
folgende Inhalte geplant und dargestellt werden:
- Bezugsmaßlinien zwischen Bauwerkskanten und Bewehrung
- Einbauteile für spätere Befestigungen
Analog Schalplan
- Planung und eindeutige Darstellung mit Einbaufolge der Bewehrungslagen
- Vermeidung von Passmaßen
Ist es unter bestimmten Umständen nicht zu vermeiden Passmaße zu verwenden, müssen diese eindeutig gekennzeichnet und die zulässigen Toleranzen angegeben werden.
- Betonierabschnittsgrenzen
Der Festlegung geht eine Abstimmung mit der ausführenden Firma und dem Statiker voraus. So muss das Bauunternehmen die Ausführung gewährleisten (genügend Schalung und Rüstmaterial vorhalten) und zusätzlich bestätigen, dass das beauftragte Mischwerk die erforderlichen Betonmengen liefern kann. Bei Sonderkonstruktionen besteht ferner die Möglichkeit, dass die Betonierfolge Einfluss auf die statische Berechnung hat.
- Minimierte Anzahl der Biegeformen
|
Inhalte von
Einrüstungsplänen |
Im üblichen Hochbau sind Einrüstpläne
und Standsicherheitsnachweise der Traggerüste nicht
erforderlich, da diese in die Traggerüstgruppe I fallen. Erst ab 5 m Höhe,
einer Länge über 6 m und mehr als 8 kN/m² Belastung ist nach DIN 4421 eine
statische Berechnung notwendig. In Einrüstplänen muss geplant und dargestellt
sein:
- Systemachsen
- Lage der Verbände
- Exzentrizitäten der Lasteinleitung
- Aussteifung des schubweichen Gerüstfußes
- Zentrierleisten
|
Fertigteilzeichnungen |
Zu den Verlegezeichnungen
muss für die Herstellung zusätzlich angegeben werden:
- Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit
- Zulässige Toleranzen
- Stückzahl und Bezeichnung
Die Rohbauzeichnungen des
Tragwerksplaners sind erweiterte Schalpläne im Maßstab 1:50. Sie enthalten zusätzlich
alle Angaben für Mauerwerks-, Stahl- und Holzbauarbeiten, die für Erstellung
des Tragwerks durch den
Bauunternehmer erforderlich sind.
|
Mauerwerksbau |
- Art des Mauerwerks, Verbandes und Steinformen
Die Angaben der Wandkonstruktion, Steineigenschaften und Mörtelgüte sind hinsichtlich der Wärme- und Schallschutzberechnung zu überprüfen.
- Bemaßung gemäß der DIN 4172 „Maßordnung im Hochbau“
- Einbauteile für spätere Befestigungen und Einbindungen
Dabei kann es sich um Fassadenverankerungen, Hülsen, Fugenbänder, Gleit- oder Dämmschichten handeln, die eine Abstimmung mit den nachfolgenden Gewerken benötigen.
- Bewehrtes Mauerwerk
- Schornsteine
- Ringbalken und –anker
- Stürze
|
Verlegezeichnungen |
Verlegepläne werden hauptsächlich für Träger- und Elementdecken, sowie zur Fertigteilmontage erstellt. Mindestanforderung für die Inhalte regelt die DIN 1045 im Abschnitt 3.2.2 – Verlegepläne für Fertigteile – : „Bei Bauten mit Fertigteilen sind für die Baustelle Verlegepläne der Fertigteile mit den Positionsnummern der einzelnen Teile und eine Positionsliste anzufertigen. In dem Verlegeplan sind auch die beim Zusammenbau erforderlichen Auflagertiefen und Abstützungen der Fertigteile einzutragen.“
Weiter sind notwendig:
- Aufhängung oder Auflagerung für Transport und Montage
- Trägerachsen mit Vermassung, Positions- und Querschnittsangabe
Diese Angaben müssen mit den Vorgaben des Objektplaners und der statischen Berechnung übereinstimmen.
- Montagestützen
- Ausbildung von Auflagern und Fugen
- Eigenlasten der Fertigteile
- Erforderliche Festigkeiten zum Zeitpunkt des Einbaus
- Eventuelle zusätzliche Bewehrungen, Ortbetonabschnitte,...